Eine Übersicht über vorangegangene Neuigkeiten und geplante Aktivitäten finden Sie hier.
| Programm Böschungsbruch und Baugrubenverbau: Im Programm Böschungsbruch und Baugrubenverbau können nun die Teilsicherheiten für das Wasser bzw. den Wasserdruck gesondert angegeben werden. Damit kann der Unterschied zwischen einem ständigen und einem veränderlichen Wasserstand erfasst werden. Nachfolgend ein Beispiel eines Damms mit Dichtungskern (Programm Böschungsbruch): 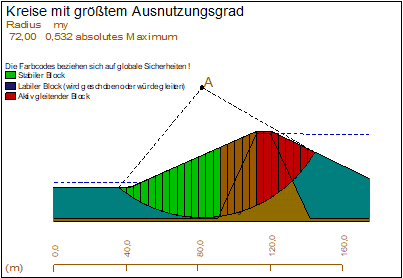 Für den Gleitkreis wurden drei Berechnungen durchgeführt, um die Unterschiede zwischen ständigem und veränderlichem Wasserstand aufzuzeigen: Zuvor noch ein Hinweis: die Teilsicherheit für das Wasser bzw. den Wasserdruck kann links und rechts vom Kreismittelpunkt gesondert als ständig oder veränderlich angegeben werden.
Bei der Gleitblockmethode kann für das Wasser bzw. den Wasserdruck nur ein Teilsicherheitsbeiwert angegeben werden. Nach ÖNORM wird dieser für den ständigen Wasserstand mit 1,00 und für den veränderlichen Wasserstand mit 1,10 angenommen. Für eine vorgegebene Gleitfläche mit Gleitblöcken ergibt sich: 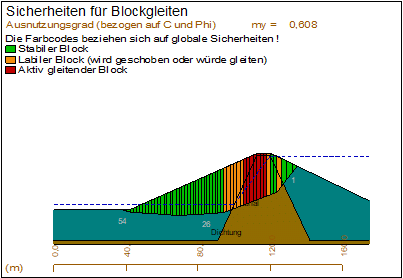
Bei Berechnungen nach DIN wird der Teilsicherheitsbeiwert für veränderliches Wasser bzw. veränderlichem Wasserdruck mit 1,30. angenommen. Im Programm Baugrubenverbau können die Teilsicherheiten (Nachweis der Horizontalkräfte und Böschungsbruch) für das Wasser bzw. den Wasserdruck vor und hinter der Wand getrennt vorgegeben werden. Dadurch kann beispielsweise ein veränderlicher Wasserspiegel vor oder hinter der Wand mit den zugehörigen Teilsicherheiten berücksichtigt werden. |